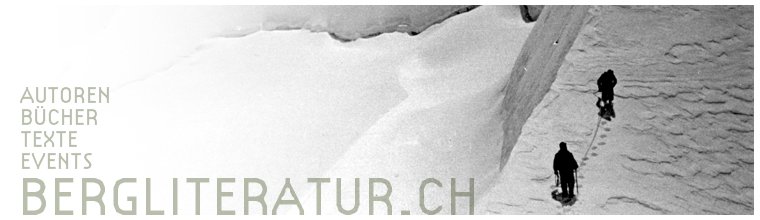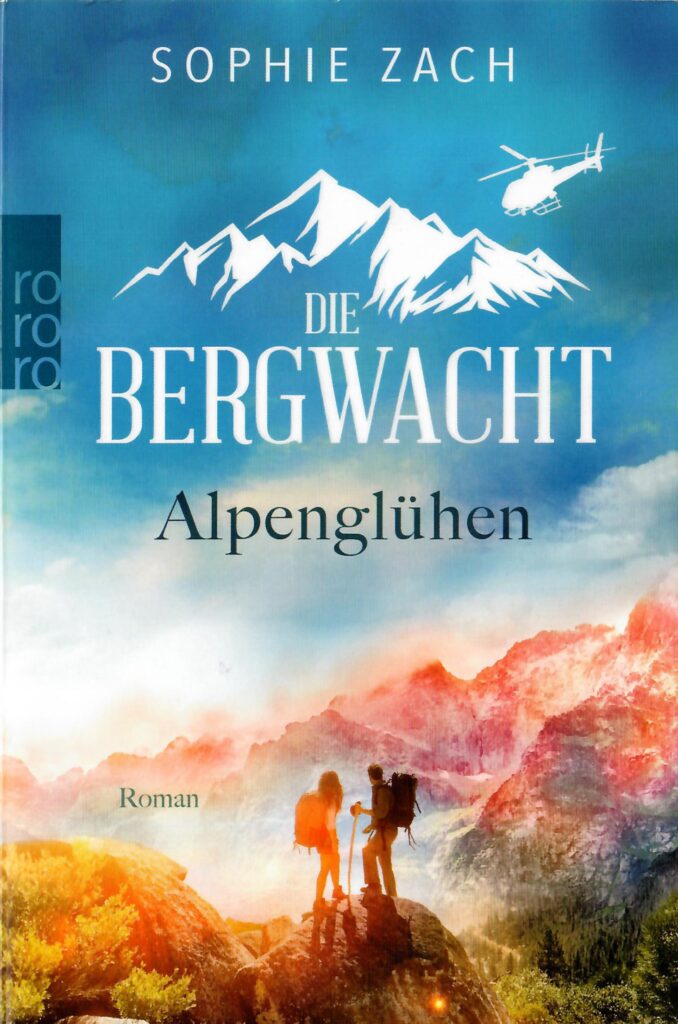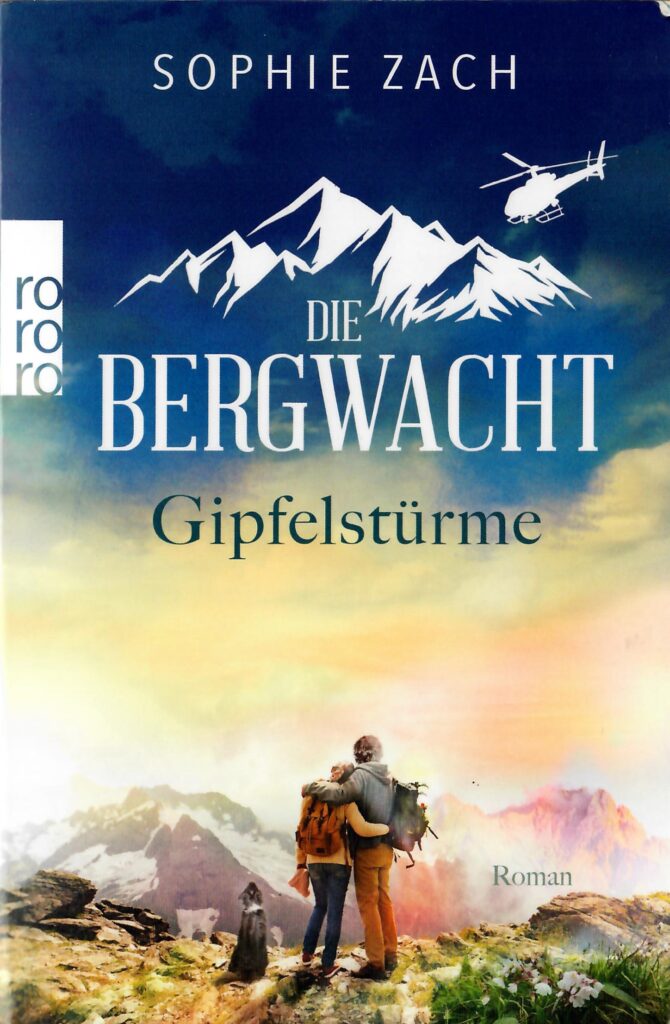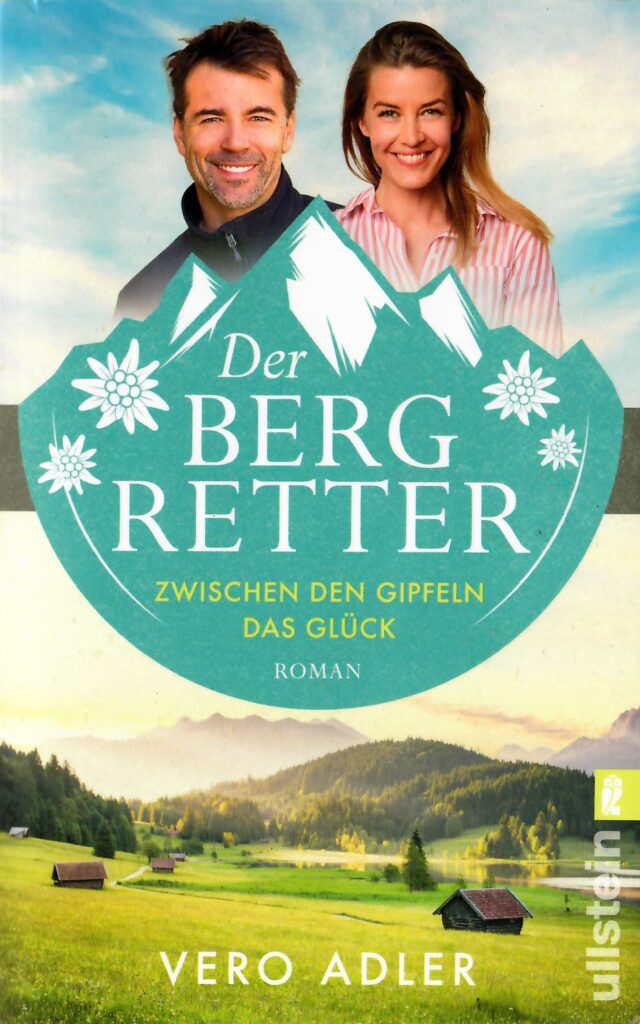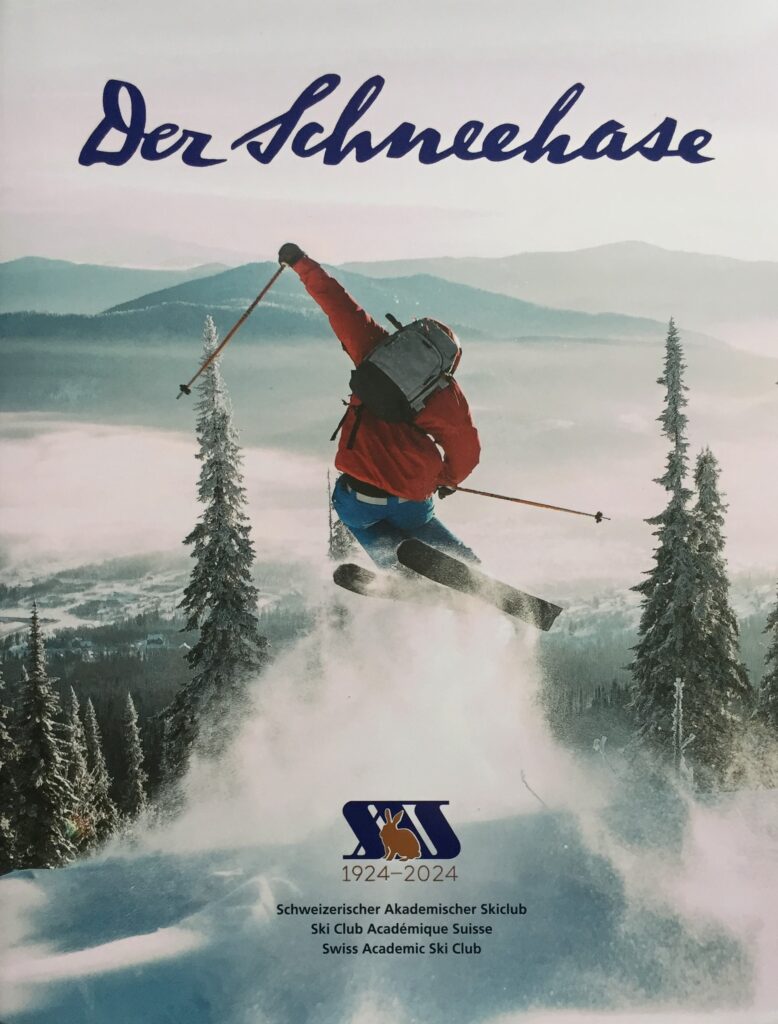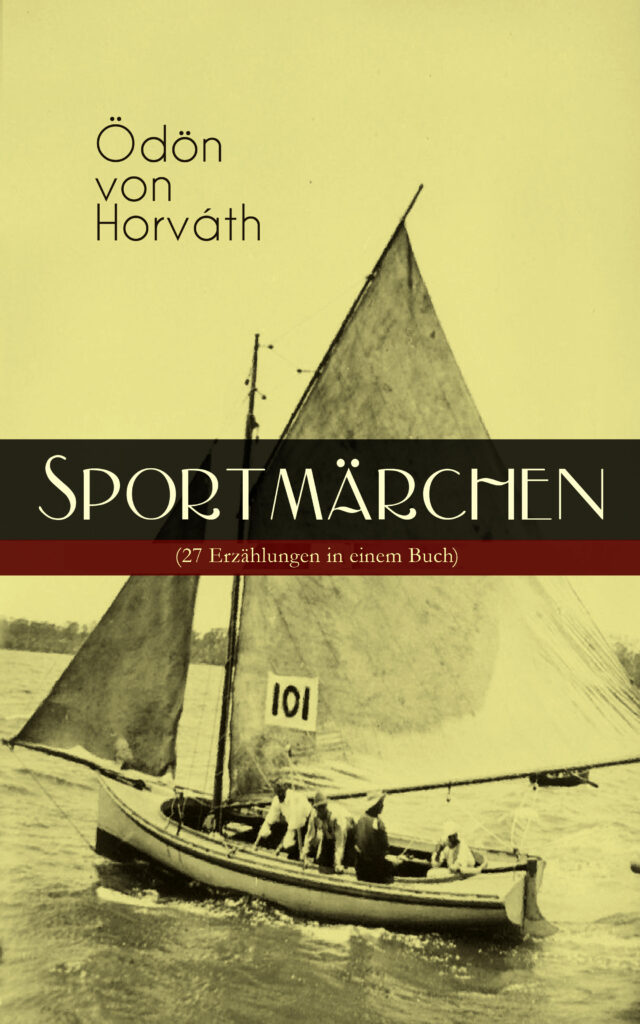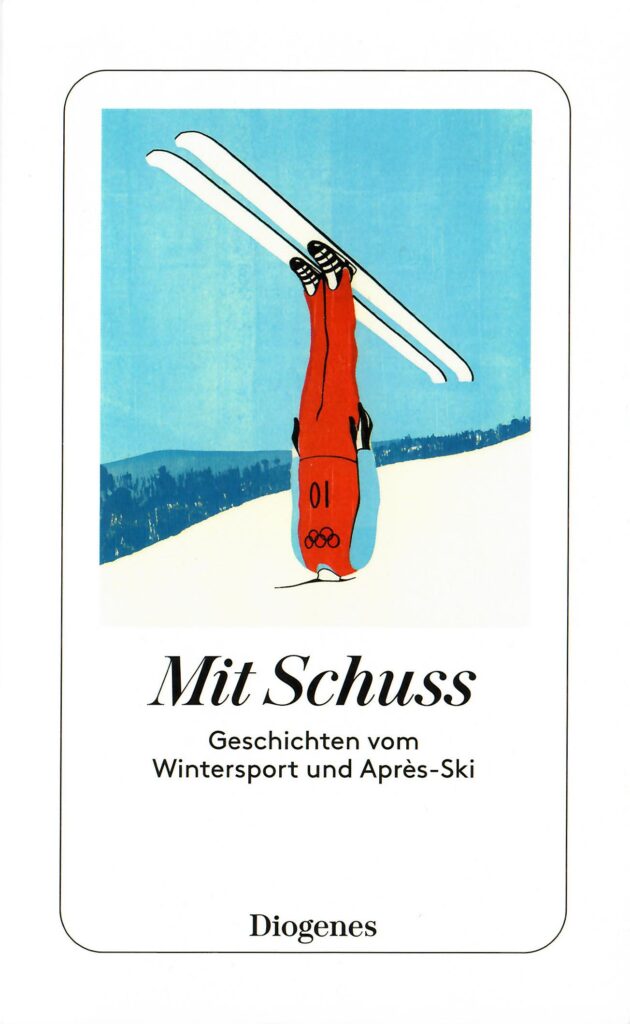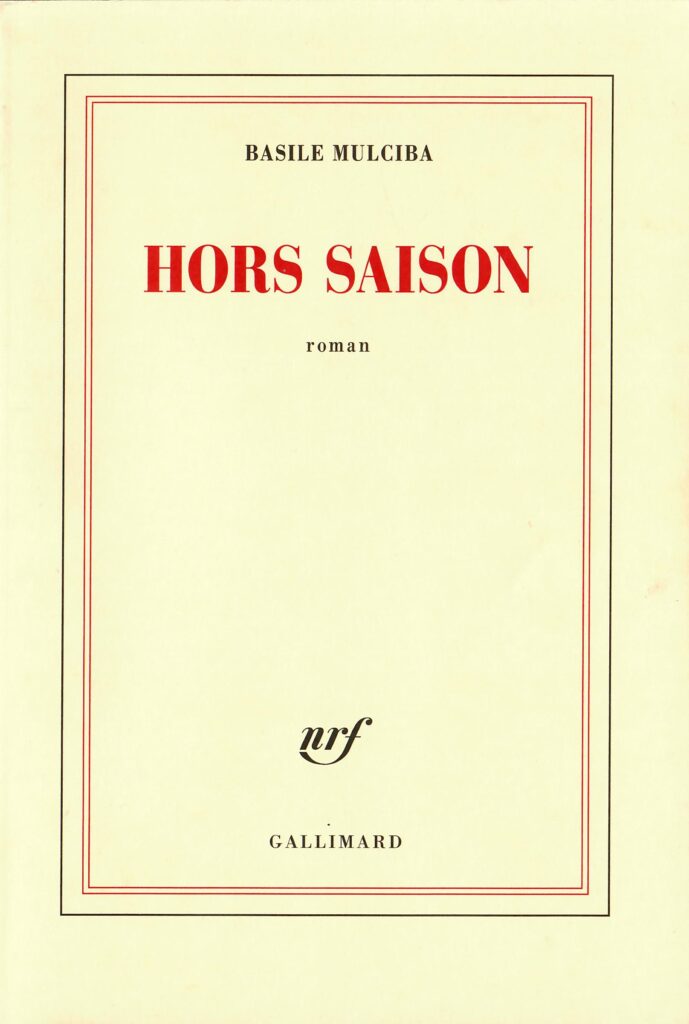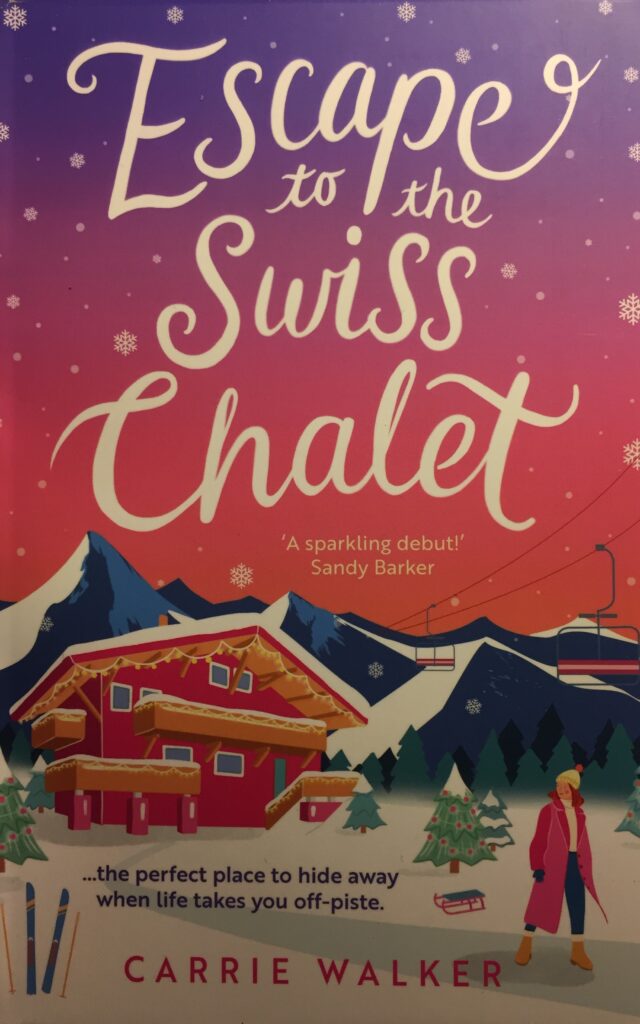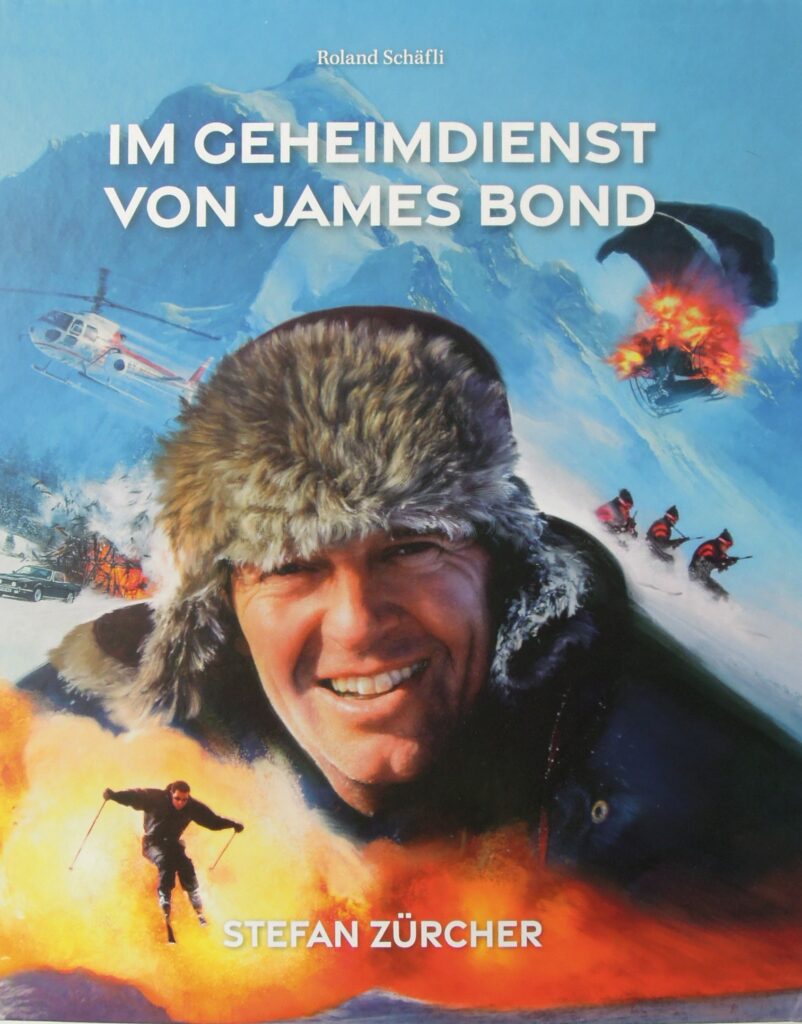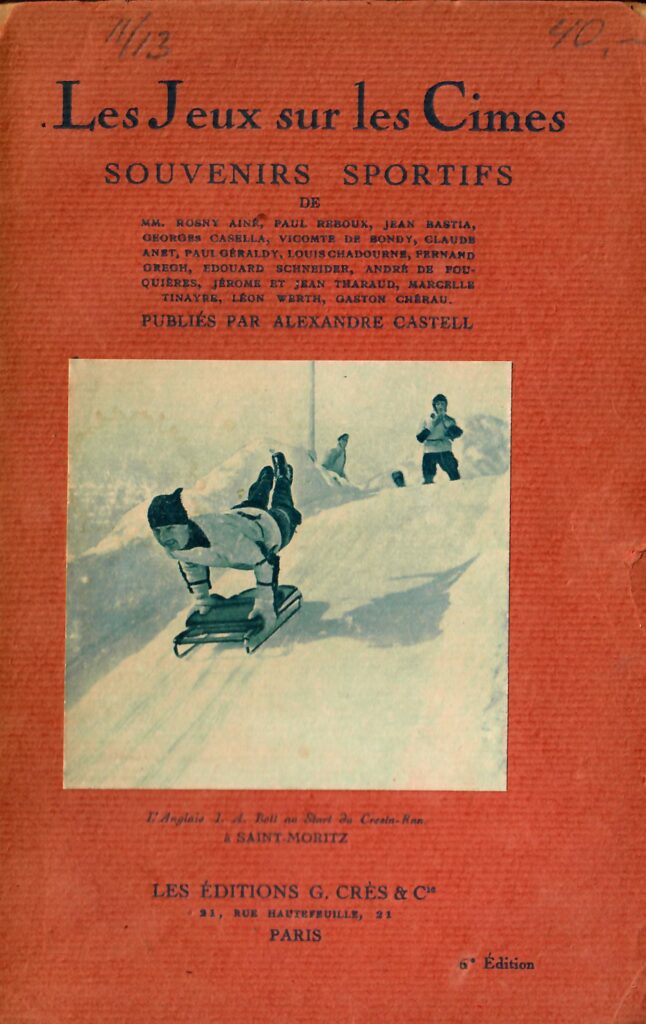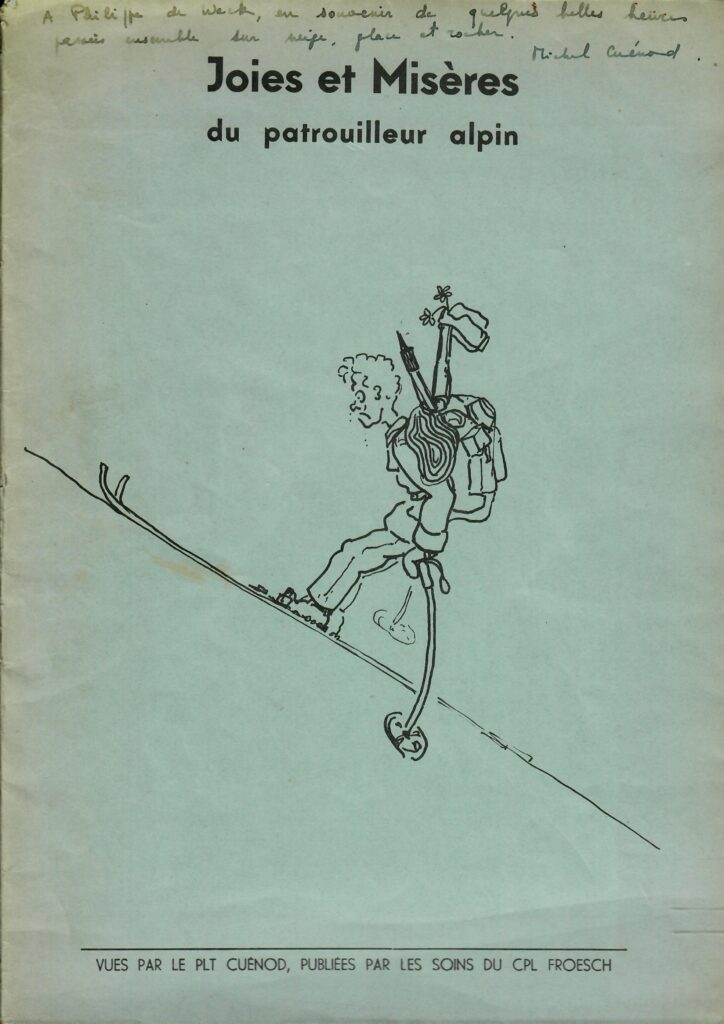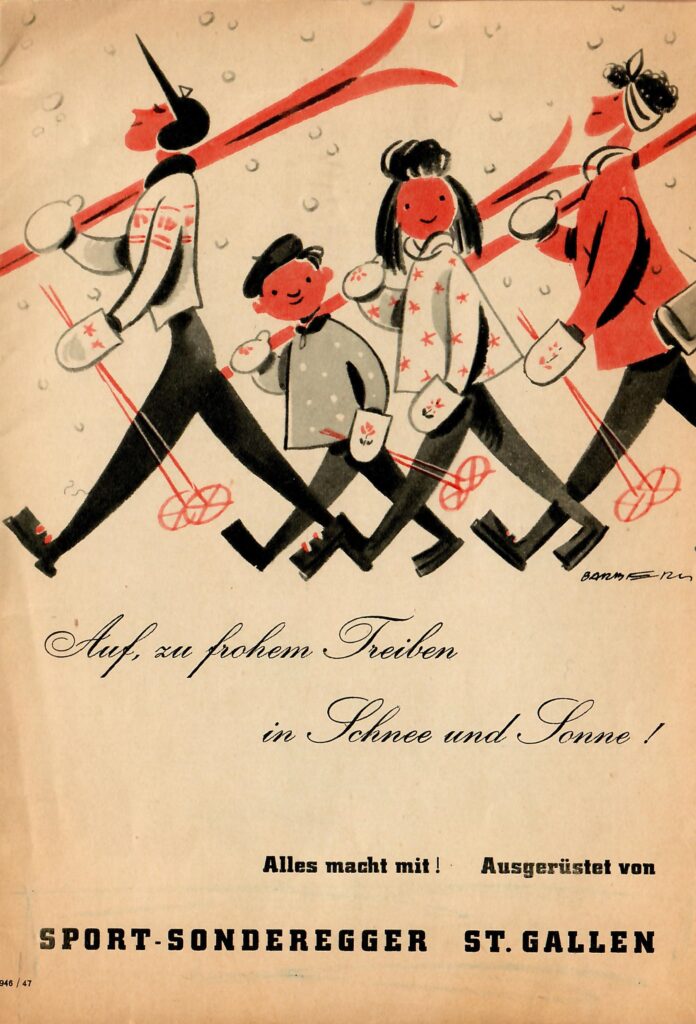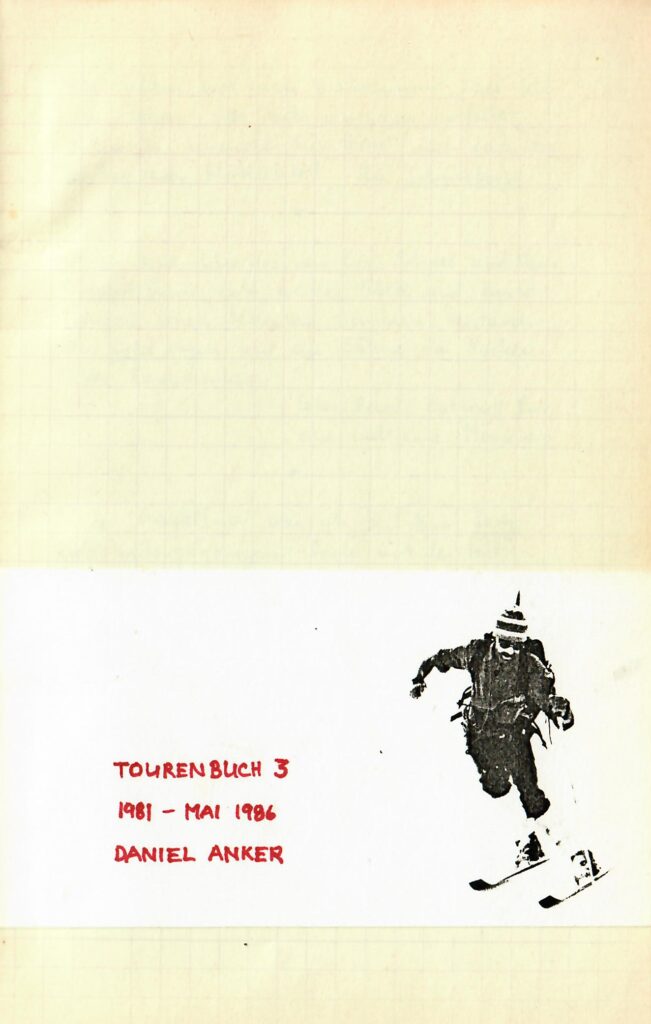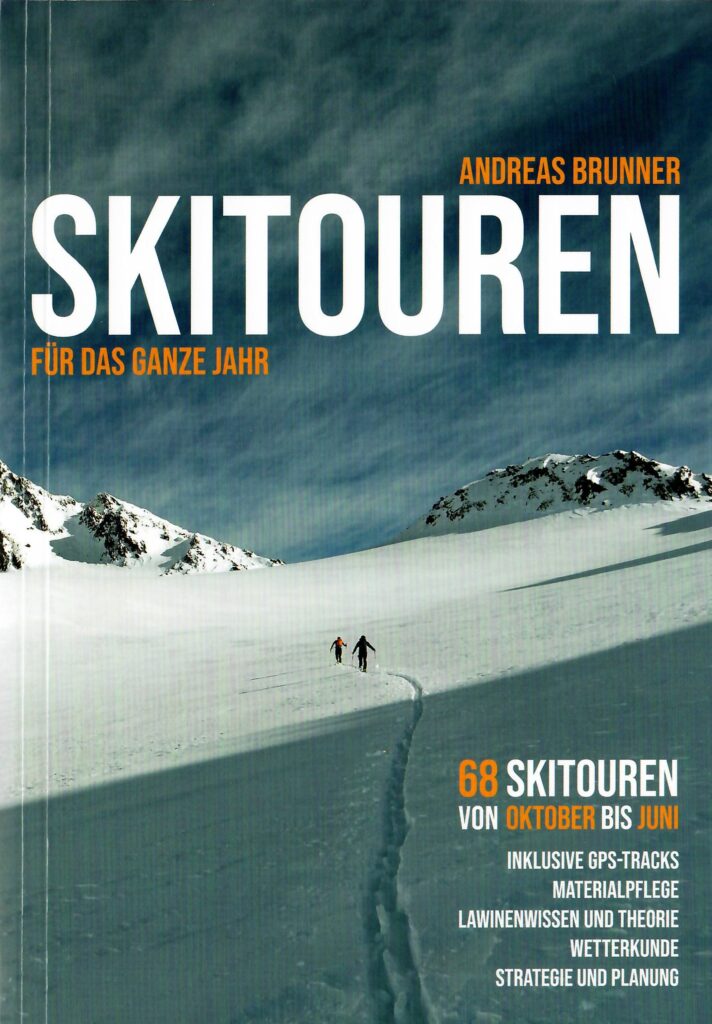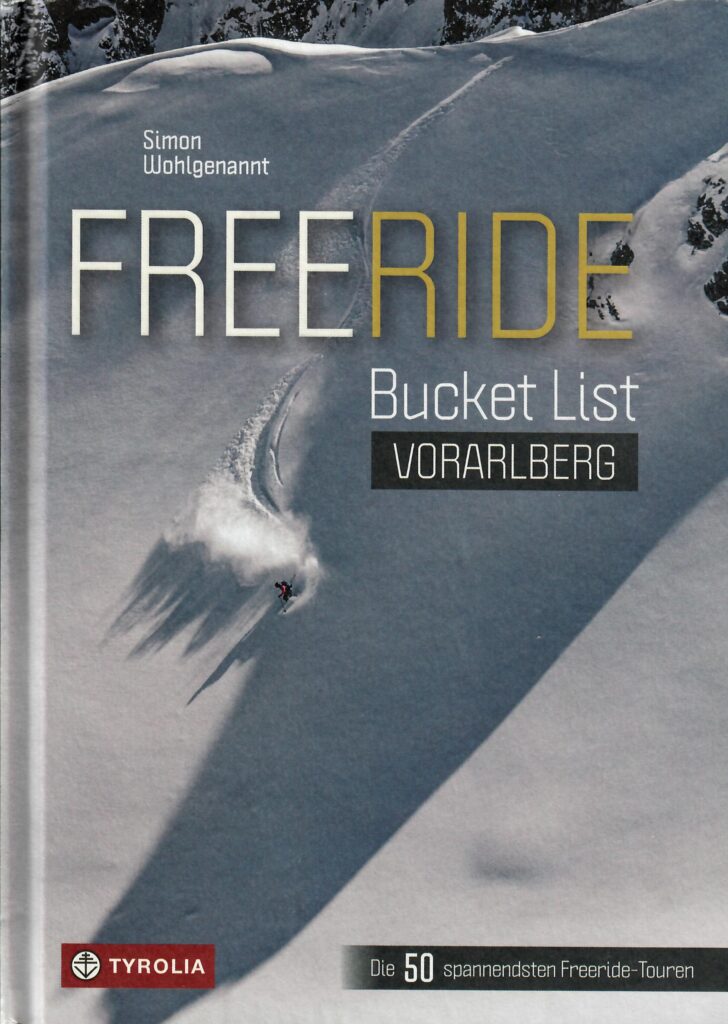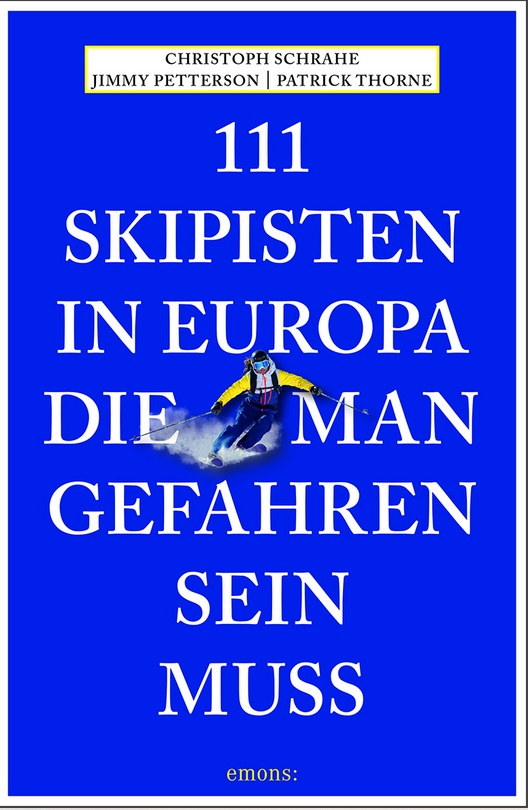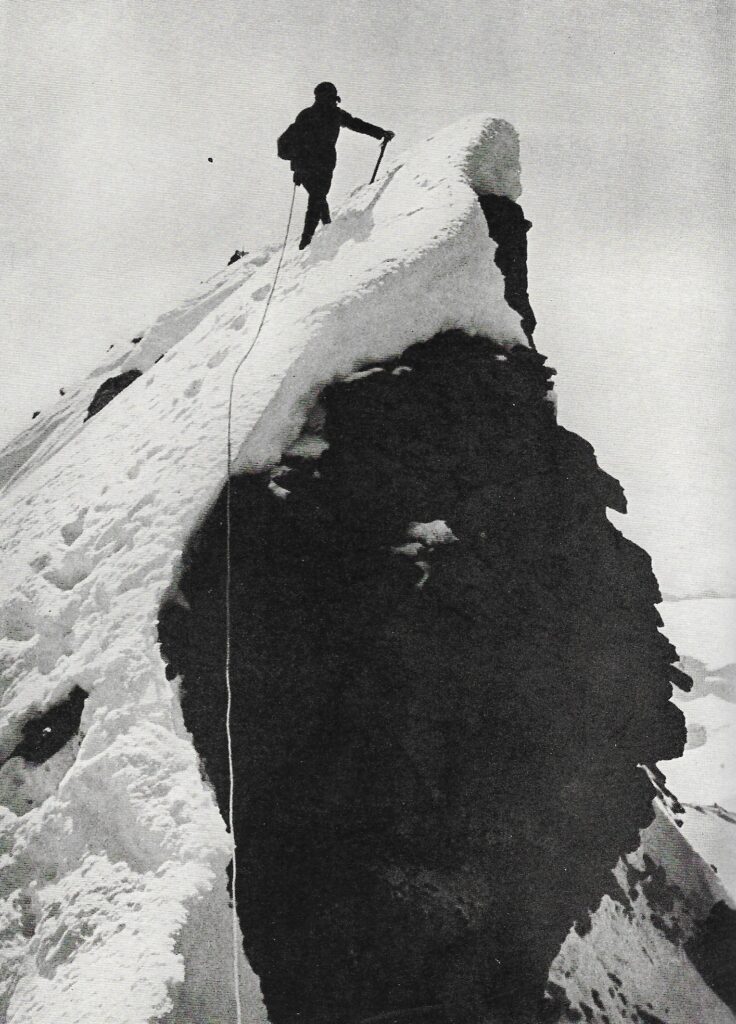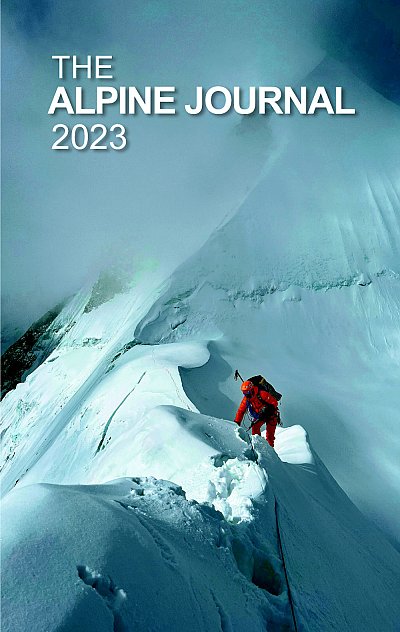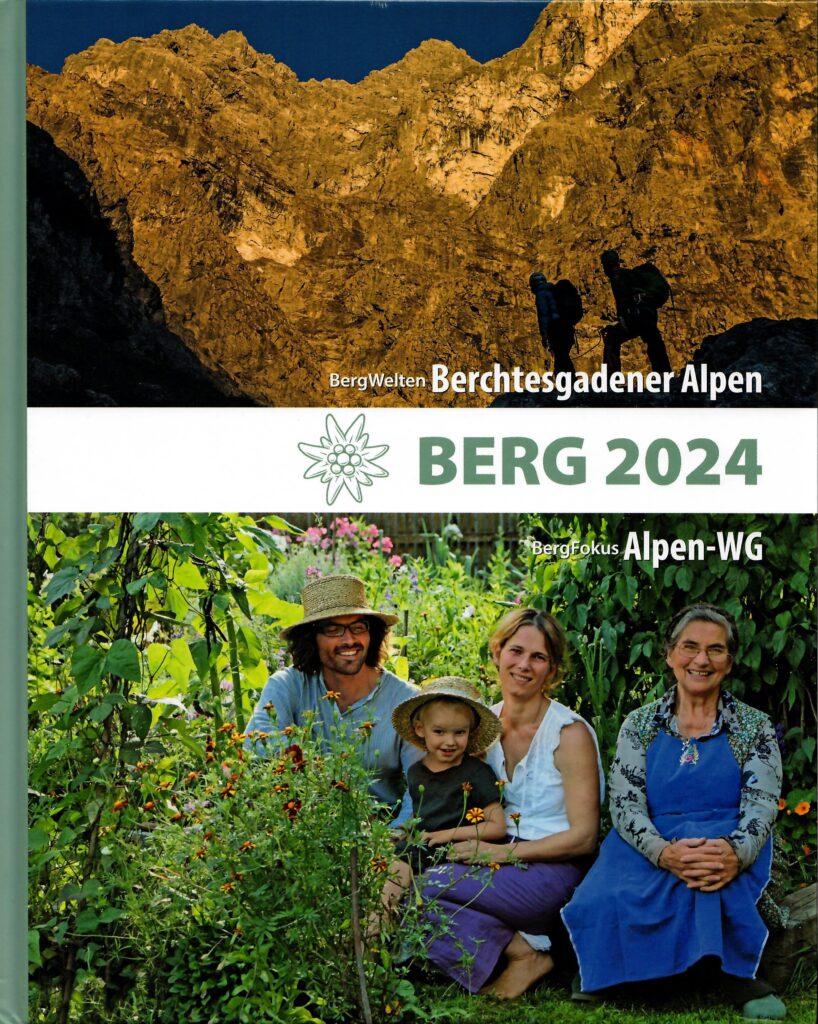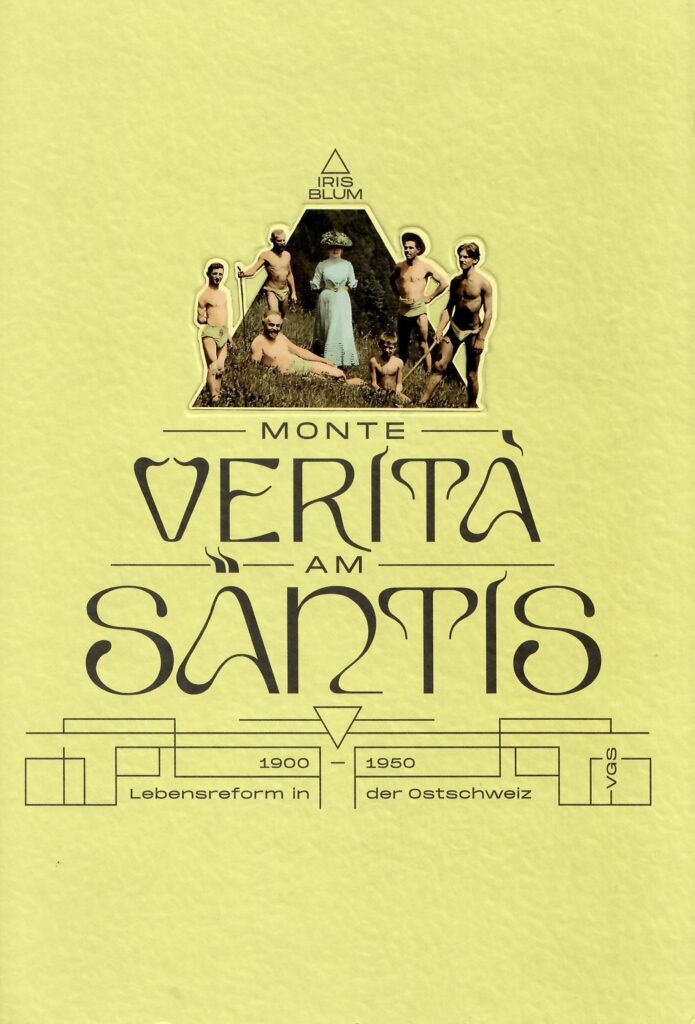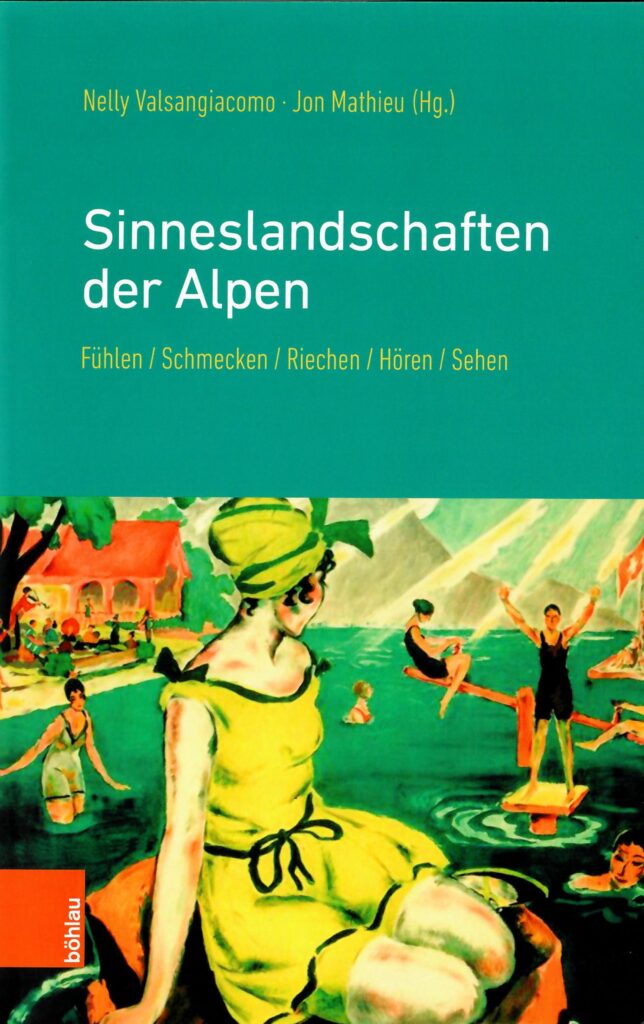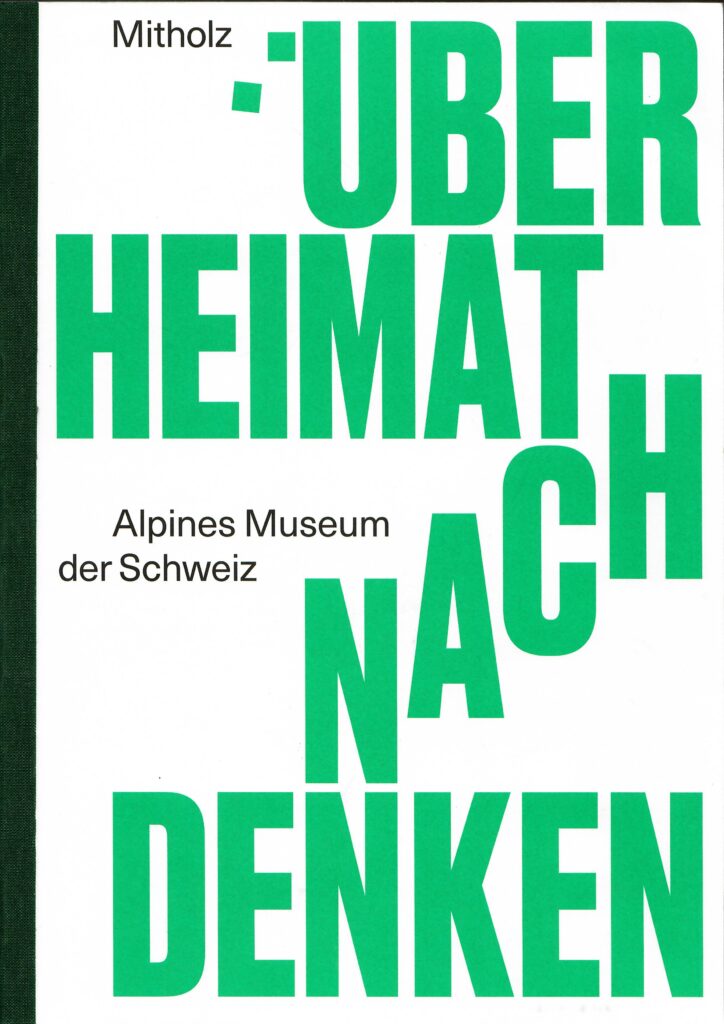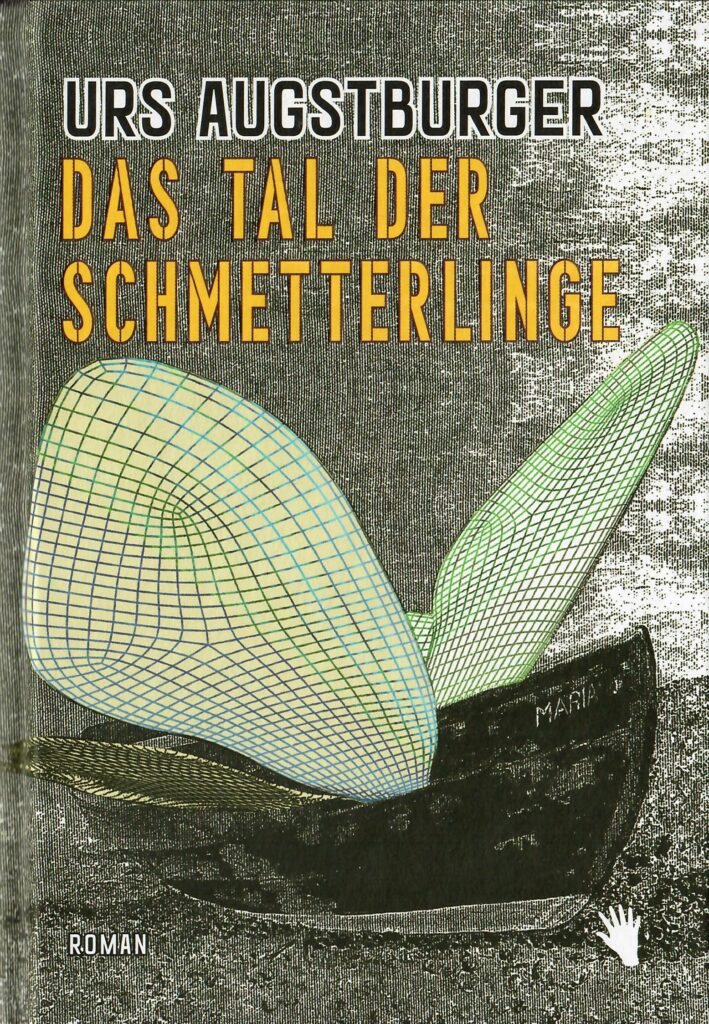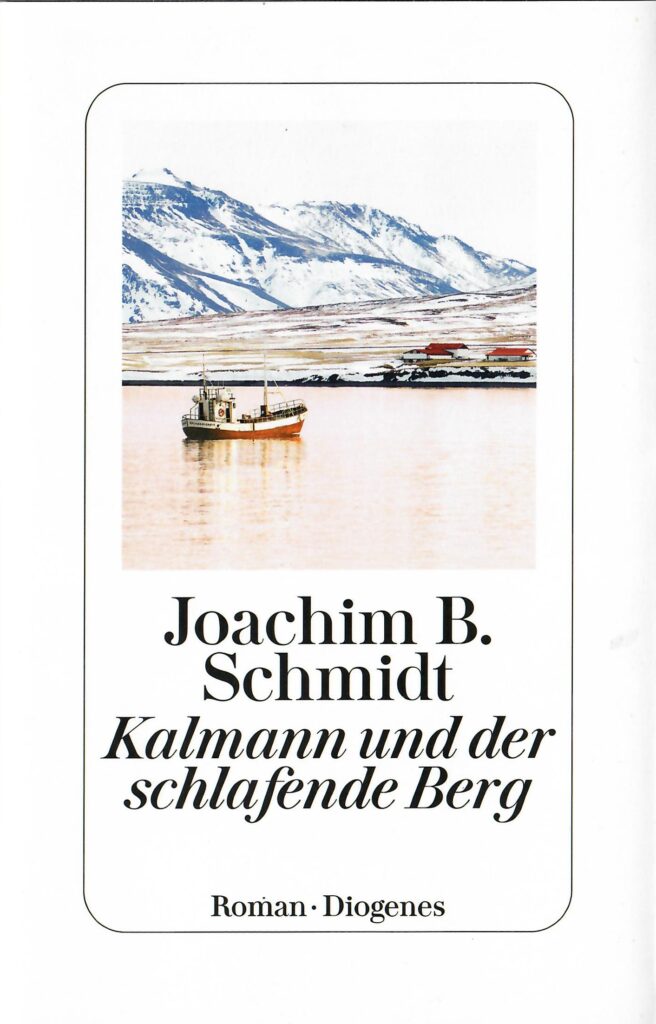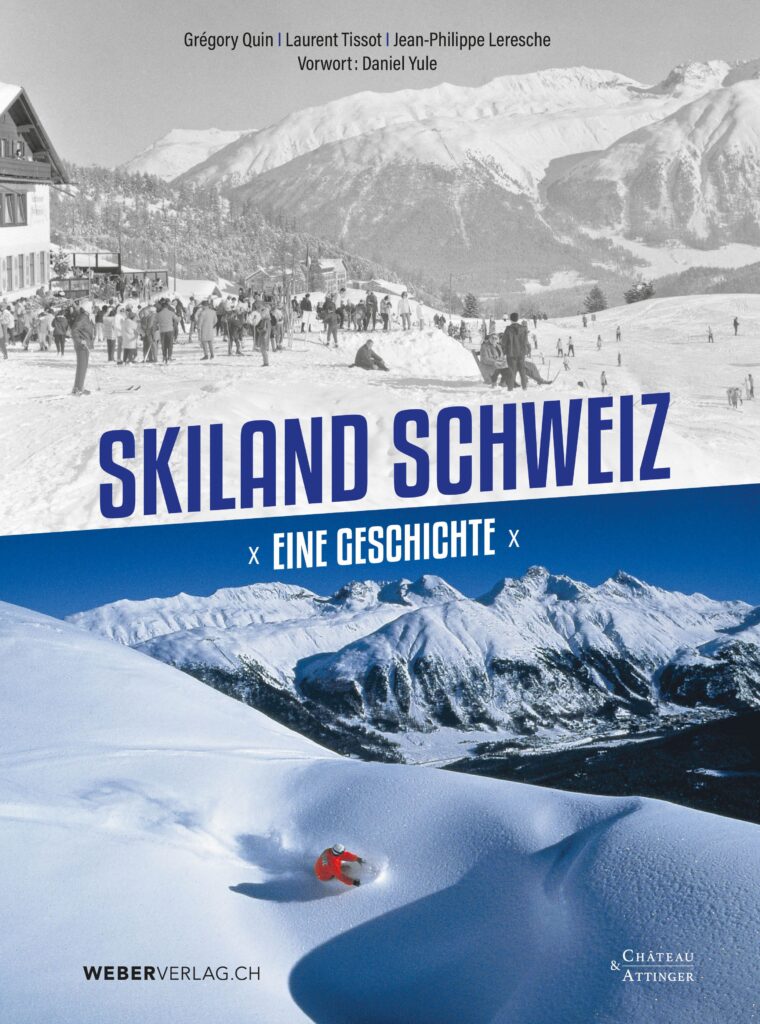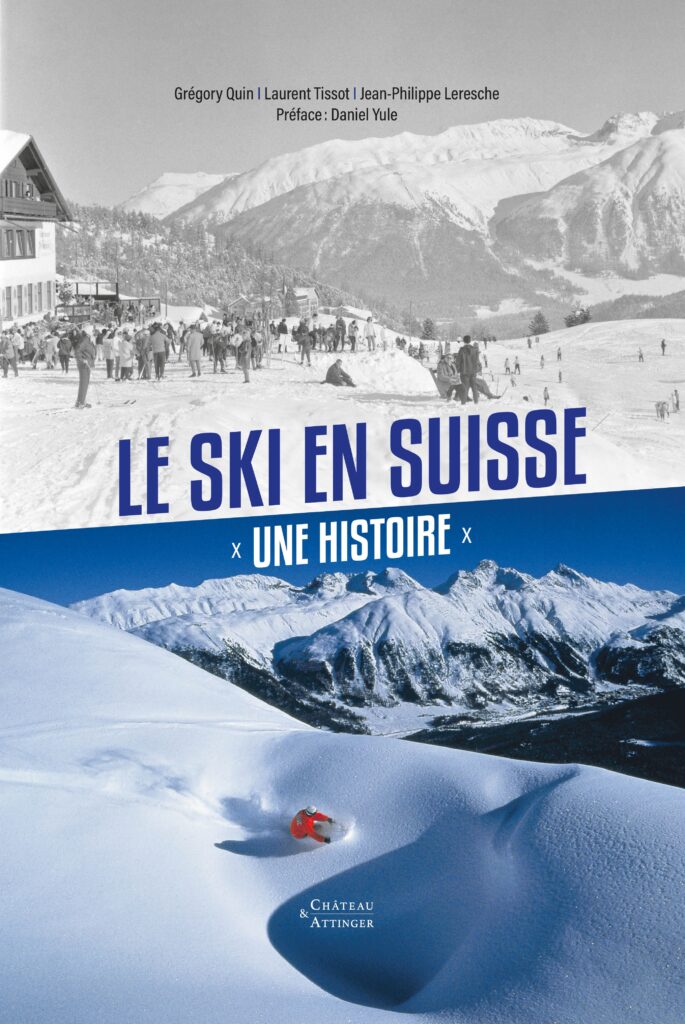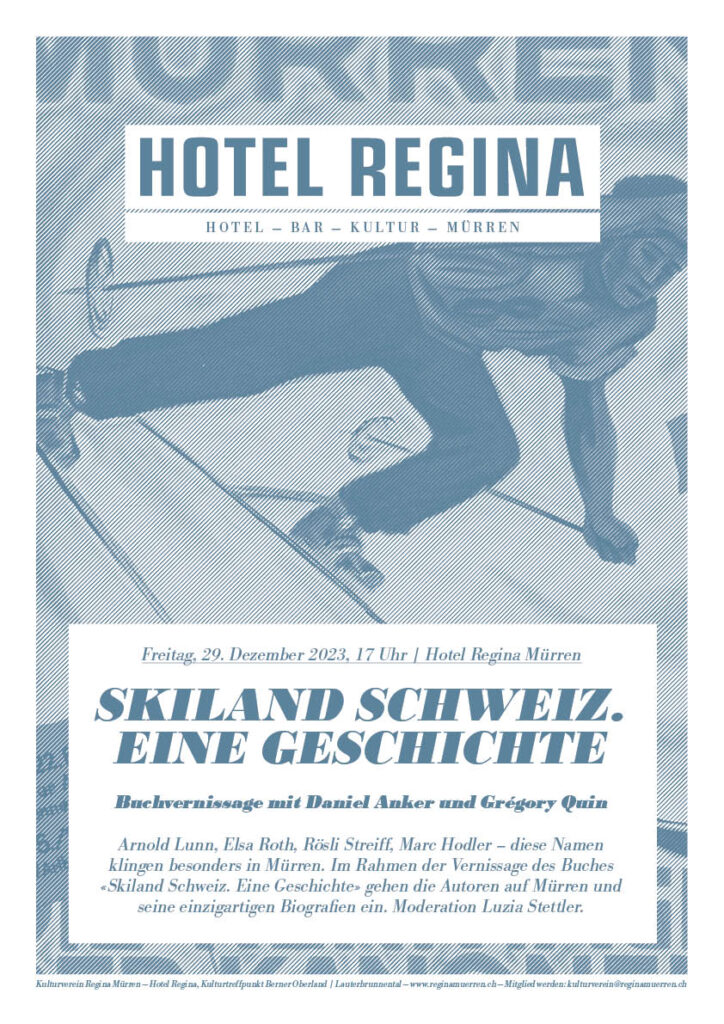Zwei neue Serien um Rettung und Liebe am Berg und im Tal. Nur lesen ist schöner als fernsehen. Am Valentinstag erst recht.
«Es knackte in ihrem Funkgerät. „Gottverdammt, was tust du?“, schrie Jonas in ihr Ohr. „Bist du okay?“
Sie gab keine Antwort, sondern hob nur den Daumen, wissend, dass er ihren Aufstieg mit dem Fernglas verfolgte. Der Schock hatte ihre Nervosität vertrieben. Sie lauschte auf ihren Herzschlag und atmete wieder ein paar Mal tief ein und aus, um sich zu beruhigen. Dann erst stieg sie weiter, Armlänge und Armlänge, bis sie endlich die Höhe des Vorsprunges erreicht hatte.»
Kurzes Aufschnaufen auch unsererseits. Das war knapp für Lena Veith, Hauptfigur in der Romanserie „Die Bergwacht“ von Sophie Zach. Und der lebensgefährliche Rettungseinsatz am berühmten Jubiläumsgrat an der Zugspitze, dem höchsten Gipfel Deutschlands, ist noch keineswegs vorbei. Denn hinter dem Vorsprung liegt Franz. Ob es der jungen Bergführerin und dem ganzen Team der Bergwacht gelingen wird, den Schwerverletzten heil ins Tal zu bringen?
Aber um Gottes Willen, heute ist doch Valentinstag! Da möchte man andere Passagen lesen, schon auch solche mit Knistern, aber nicht im Funkgerät. Bitte: «Während Ramsauer die Sitzung eröffnete und zunächst ein paar unwichtigere Dinge besprochen wurden, war sich Lena Bens Nähe so deutlich bewusst, dass sie fast versucht war, mit ihrem Stuhl etwas nach hinten wegzurutschen. Es erschien ihr geradezu ungehörig, so nah beieinanderzusitzen. Sie konnte die Wärme spüren, die Bens Körper ausstrahlte, nahm seinen Geruch nach frischer Luft, Holzrauch und irgendetwas Herbem wahr und wagte es nicht, den Kopf zu drehen und ihn anzuschauen. Ihr war heiß.»
Uns auch! Ausgerechnet der unsympathische Ben, den Lena seit der Schulzeit kennt. Und was ist eigentlich mit Jonas, dem Kollegen im Team der Bergwacht im fiktiven Ort Bichlbrunn bei Garmisch-Partenkirchen? Selber lesen und mitfiebern in den beiden erschienenen Bänden „Alpenglühen“ (daraus das erste Zitat) und „Gipfelsturm“ (daraus das zweite). Und sich freuen auf den dritten Band, der allerdings erst in einem Jahr erscheinen wird.
Action am Berg und in der Stube, unterbrochen von idyllischen und herzzerreissenden Szenen. Die Berge, die so unberechenbar wie das Leben sind. Man kennt das von erfolgreichen alpinen TV-Serien. Im ZDF treten die „Die Bergretter“ auf, deren ersten Folgen ab November 2009 unter dem Namen „Die Bergwacht“ ausgestrahlt wurden; 2012 erfolgte die Umbenennung in „Die Bergretter“. Im ORF hilft „Der Bergdoktor“ seit 2008 am Berg wie im Tal; die Arztserie ist eine Neuauflage der gleichnamigen deutsch-österreichischen Fernsehserie „Der Bergdoktor“ (1992–1997). Beide basieren auf Motivvorlagen der erfolgreichen Heftromanserie gleichen Namens. Lesen und fernsehen verstehen sich gut.
Dieser Meinung war offenbar nicht nur der Rowohlt Verlag mit „Die Bergwacht“. Denn ebenfalls im letzten Jahr startete der Ullstein Verlag die Serie „Der Bergretter“ von Vero Adler. Auch sie spielt in Garmisch-Partenkirchen und am Jubiläumsgrat, auch da gibt es alpine Rettungseinsätze sowie Konflikte und Konsolation weiter unten. Hauptfiguren sind Leonhard Gerstorff, Arzt in der Kinder-Rheumaklinik, und Frederika Altenberger, Mitglied der Bergwacht. Finden sich die beiden endlich, oder kommen immer Einsätze sowie Leonhards Exfrau dazwischen? Genau so ist es. Ein dritter Band ist noch nicht angekündigt. Doch so offen soll der Lektüre-Hinweis am Valentinstag nicht enden. Deshalb hier ein Zitat von Seite 250 in Band 2: „Oft lief Leonhard abends mit Frederika durch die erleuchteten Straßen, meist schneite es, und das machte alles noch viel schöner.“ Schön wär’s, diese Bemerkung sei erlaubt, wenn es auch ausserhalb von Romanen wieder mal schneite.
Sophie Zach: Die Bergwacht. Band 1: Alpenglühen; Band 2: Gipfelstürme. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2023. Der dritte Band, Schneetreiben, erscheint im Januar 2025. Je € 12,00.
Vero Adler: Der Bergretter. Band 1: Zwischen den Gipfeln das Glück; Band 2: Zwischen den Gipfeln die Liebe. Ullstein Verlag, Berlin 2023. Je € 12,00.